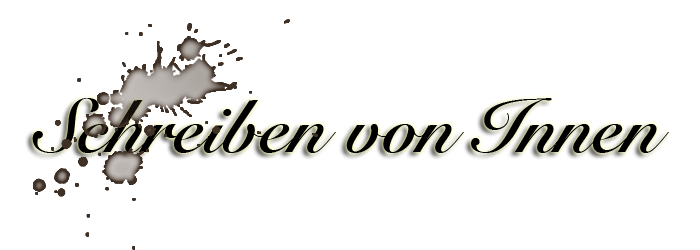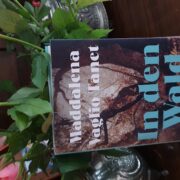Es war erst ein paar Stunden her, da saß Wilhelm noch auf seinem Lieblingsplatz: Auf der Theke neben der Kasse im Tante-Emma-Laden von Oma Gertrud. Neben dem Adventskranz, der inzwischen die meisten Nadeln verloren hatte. Dort hatte er noch der Frau Mayer, mit „ay“ ein Kompliment zu ihren frisch ondulierten Haaren gemacht. Ein Kompliment, welches sie nach jedem Friseurbesuch von ihm zu hören bekam. Ihn freute es, dass sie sich darüber freute. Ihn erfreute auch die darauffolgende Tüte mit Süßkram: „Gertrud, pack dem Jungen für 50 Pfennig Süßkram in die Tüte.“
Er mochte diese Routine.
Die Wangen mit Bonbons vollgestopft, verabschiedete er eine andere Kundin: „Tschüss, Frau Erkelenz.“
„Junge, das heißt „Auf Wiedersehen“. Tschüss sacht man nicht.“
„Oma, die Marta sagt aber immer tschüss.“
„Seit wann nennst Du Fräulein Busche Marta?“
„Oma, sie hat gesagt, ich bin jetzt groß genug, um sie Marta zu nennen. Und zum nächsten Tanzabend wird sie mich mitnehmen.“
„Junge, Du kannst doch nicht einmal tanzen. Und überhaupt, was willst Du denn anziehen?“
„Dein schönes Unterkleid oder Opas Anzug.“
Als sich Oma Berta kopfschüttelnd umdrehte, dabei murmelte: „Woher kennt der Junge mein Unterkleid?“, wechselte Wilhelm das Thema.
„Oma, soll ich noch eine Flasche Eierlikör für nachher mitnehmen?“
„Wenn eine reicht? Wenn nicht, musst Du nachher noch mal rüber laufen.“
Jetzt saß er im Lieblingssessel von Opa Albert. Die Kerzen am Weihnachtsbaum wackelten, da Oma Gertrud mit ihrem Albert zu ihrem Lieblingslied tanzte.
Sie hielt es wie die Holländer. Keine einzige Gardine hing in den Fenstern, so dass Nachbar Anton und der Mond ihre sicheren Tanzschritte sehen und vermutlich ihren Gesang hören konnten.
Trug sie hinter der Kasse in ihrem Tante-Emma-Laden immer einen geblümten Kittel, dazu ihre neuen bequemen Birkenstock Schuhe, die sie am liebsten nicht mehr ausziehen wollte, so hatte sie sich nun in Schale geschmissen. Die Pantoffeln gegen Spangenschuhe mit einer schicken Schleife vorne getauscht und ein wunderschönes, schwingendes rot gepunktetes Kleid angezogen. Es fehlte nur noch der kleine Hut, den sie sonst auf Beerdigungen trug, den Wilhelm allerliebst fand. Damit sah sie aus wie eine Prinzessin. Eine ältere Prinzessin.
Wie es mit der üblichen Schiesser Feinripp Unterhose aussah, konnte nur vermutet werden.
Noch war ihr Gesang nicht so schräg, dass der Mond sich hätte riesige Kopfhörer aufsetzen wollen.
Feierschichten, Rußlungen, rußgefärbte Häuser, der Smog oder die Forderung Willy Brandts, der den Himmel über dem Ruhrgebiet wieder blau haben wollte: All das war für den Moment vergessen, wenn Oma Gertrud in Opa Alberts Arm zum Mond von Wanne-Eickel tanzte und dem Plattenspieler schwindelig wurde, vom wieder und wieder aufsetzen der Nadel auf die Platte.
Nichts ist so schön wie der Mond von Wanne-Eickel,
die ganze Luft ist erfüllt von ew’gem Mai (hmmm).
Und jede Nacht am Kanal von Wanne-Eickel
ist voller Duft wie die Nächte von Hawaii.
Diese Zeilen sang Oma Gertrud immer wieder mit. Hörte man genau zu, konnte man leises Fernweh erahnen? Wünschte sie sich manchmal weit weg von ihrem Tante-Emma-Laden, der ihr ein und alles war und dennoch einzwängte?
Wilhelm suchte die gute Flasche Eierlikör raus, nach diesem Sport würde Oma ein Likörchen brauchen. Oder auch zwei. Wenn es drei wurden, bot sie ihm meist das dritte Pinnchen zum Ausschlecken an.
Für Opa Albert holte er die Flasche Asbach aus dem Wohnzimmerschrank. Er kannte den Opa gut. Um in den Genuss einer Tanzpause, oder Hörpause, zu kommen, würde er nicht nein zu einem Gläschen sagen.
Inzwischen war es dunkel. Zeit Schnittchen für die gleich eintreffende Sippe zu machen. Doch ein Tanz musste noch sein.
Der Mond von, ja von wo, schaute zu. Sowie die Nachbarn.
Heiligabend 2024:
Getrud Becker
1905 – 1986
steht auf dem Grabstein
„Prost, Oma Gertrud.“
Wilhelm, der inzwischen auch Opa ist, stellt ein Glas Eierlikör auf ihrem Grabstein ab, während er seins auf Ex leert.
Nichts ist so schön wie der Mond von Wanne-Eickel,
die ganze Luft ist erfüllt von ew’gem Mai (hmmm).
Und jede Nacht am Kanal von Wanne-Eickel
ist voller Duft wie die Nächte von Hawaii.
Ich kenn’ die ganze Welt von Rio bis Port Said,
ich war zu Gast im Zelt beim Ölscheich von Kuwait.
Ich kenn’ die Cote d’Azur, die Rosen von Athen,
Mallorca, wo am Kai Germanen Schlange steh’n.
Und jeder staunt ganz ungemein,
doch ich sag’ nein, nein, nein, nein, nein – ich sage nein!
Nichts ist so schön….
Frau Adelgunde Schmidt, die schwärmte jedes Jahr,
wenn sie aus Spanien kam, wie schön der Mondschein war.
Denn sie hat nachts am Strand bei Vollmond noch entdeckt,
dass jeder Kuss direkt nach Tarragona schmeckt.
Und jeder staunt ganz ungemein,
doch ich sag’ nein, nein, nein, nein, nein – ich sage nein!
Nichts ist so schön….