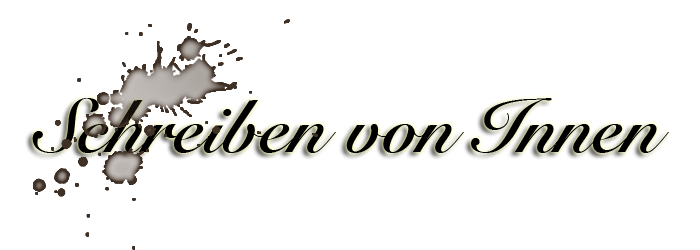Juli 2020
Jetzt stehe ich hier und kann Dich auf dieser Trauerfeier nicht gehen lassen, ohne Dir noch einige Worte auf den Weg zu geben. (Sorry, ich kann einfach nicht anders.)
Du weißt, die Vorstellung von einem Himmel oder einer Hölle, des Mannes im weißen Gewand und mit weißem Rauschebart überzeugten mich nie. Aus irgendwelchen Gründen glaube ich ja fest an die Wiedergeburt.
So absurd die Vorstellung eines Himmels für mich ist, so kann ich mir gut vorstellen, dass Du neben Deinem Bruder Manni auf einer Wolke sitzt, die Beine baumeln lässt und Dich dort wohlfühlst – wo immer diese Wolke auch sein mag. Manni hat eine Thermoskanne mit starkem Kaffee zwischen Euch stehen, nimmt einen kräftigen Zug von seiner Zigarette und sagt. „Hey, Petra, schaue hinunter. Dort unten: Das ist heute DEIN Tag!“
Von hinten kommt Dein Vater in kleinen Schritten und flucht, dass er Euch erst jetzt gefunden hat. Tante Hilde nimmt heute eine Auszeit von der Wolke.
Denke ich darüber nach, kommen mir bereits die Tränen. Ich versuche tapfer zu sein, damit Du meine Worte verstehen kannst und sie nicht erahnen musst.
Welche Spuren kann ein Mensch auf der Erde oder dem Universum hinterlassen? Du hast Deine Spuren hinterlassen. Fünf Kinder und sechs Enkel würde es ohne Dich nicht geben. Mich würde es nicht geben.
Während ich über die Worte für Deinen Abschied nachdachte, fiel mein Blick auf die Einladungskarte zu Deinem 60. Geburtstag. Du hattest eine große Feier geplant und dann kam der Nierenkrebs dazwischen. Wir hatten für Dich eine Reise nach Irland gebucht, dem Land in dem Du zweimal Urlaub gemacht hast, als ich dort wohnte. Du wolltest so gerne noch einmal dorthin reisen.
Die große Feier und die Reise fielen aus und konnten nie wieder nachgeholt werden.
Ab dann gab es immer wieder kritische gesundheitliche Situationen in Deinem Leben.
Ich weiß nicht mehr genau, wie oft Du dem Tod von der Schüppe gesprungen bist. Auch, weil Deine Patientenverfügung missachtet wurden. Du kamst immer wieder hoch. Du hast dem Tod immer ein Schnippchen geschlagen, warst schneller. Wie im Juli vor zwei Jahren, als auch mit Mimis Hilfe, Dein Leben gerettet wurde.
Nun haben wir wieder Juli, dieses Mal bist Du nicht von der Schüppe gesprungen. Jetzt hast Du einen Weg gefunden, Deinen Weg zu gehen, ohne dass Dir noch einmal jemand in Form von Krankenhaus, Notarzt o.ä. dazwischen pfuscht.
Du hast einen stillen Weg genommen, der für Dich hoffentlich friedlich war. Und ist.
Montag telefonierten wir noch und am Donnerstag gab es Dich plötzlich nicht mehr. Das Wort „plötzlich“ hat für mich nun eine ganz andere Dimension bekommen.
Apropos Weg: Während ich das Wort ausspreche, denke ich an den Weg in Oberstdorf, der am Bach entlangführte. Diesen Spaziergang am Bach entlang mochten Didi und Du so gerne. Er gehörte zu Euren Urlauben in Oberstdorf dazu. Gelegentlich besuchte ich Euch dort.
Erinnerst Du Dich, als ich bei einem Spaziergang am Bach entlang. die nicht eingelaufenen roten Schuhe trug und mir böse Blasen lief? Wenn wir uns später daran erinnerten lachten wir meist, da ich mir nach dem Spaziergang humpelnd im Schuhgeschäft die erstbesten Schuhe, die hinten offen waren, kaufte. Oder an den Eisstand mit dem leckeren Eis? Und an den feschen Jungbauern in der Milchbar? Erst im Mai schauten wir uns noch Erinnerungsstücke aus Oberstdorf an.
Ich verbrachte einige Urlaube mit Dir und Didi im Allgäu. Gemeinsame Erinnerungen, die weiter bestehen bleiben. Die Kaffeepausen im schlichten Museumscafé in Wangen, der Rundweg am Waldsee in Lindenberg. Lindau, den Bodensee und viele andere Orte erlebten wir gemeinsam.
Mama, wenn ich an Dich denke, sehe ich nicht nur die letzten 9 Jahre, in denen Dich seit dem Nierenkrebs häufig Krankheit und Phantomschmerzen dominierten.
Du warst rst so viiiiel mehr:
Die die jüngsten Enkel abgöttisch liebte
Die ein großes Haus nicht nur in Schuss hielt und dieses später räumte. Am Wochenende des Umzugs lud ich Dich nach Hamburg ins Hotel Atlantik ein, damit Du am eigentlichen Akt des Umzugs nicht anwesend sein musstest. Wir logierten im schicken Hotel. Auch hier lachten wir später über gemeinsame Erinnerungen. Wie ich erst im anderen, falschen schicken Hotel einchecken wollte und mich kaum davon abbringen ließ, dass ich die Hotelnamen verwechselt hatte und somit an der falschen Rezeption stand.
Die großzügig war
Du konntest tanzen und Dich führen lassen. 1.2.3. tschatschatscha klappte bei Dir wunderbar
Die damals so viel Spaß mit ihren Strickweibern hatte
Die eine Überlebenskämpferin war
Die ihren Dickkopf und auch Egoismus durcchzusetzen wusste
Die Spaß an der Arbeit mit Gästen in der Gastronomie u.ä. hatte
Die ihren Didi betüdelte solange sie es konnte
Die es genoss in einer „Hells Angels“ Kneipe eine Cola zu trinken und irgendwie hoffte, dass jetzt auch etwas passieren würde 🙂
Im März und Mai sahen wir uns noch und nichts deutete auf den 9. Juli hin. Nichts. Heute bin ich froh, Dich diese insgesamt viereinhalb Wochen noch gesehen und erlebt zu haben.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie Du, auf dem Weg in die Stadt, mit Deinem Elektro Rolli den Bürgersteig verließt, auf die Straße fuhrst, an deren Straßenrand sehr viele Autos parkten und entgegen der Fahrtrichtung mit geradem Rücken Gas gabst. Autos, die um die Kurve kamen, mussten bremsen. Scharf bremsen. Auf mein ängstliches Geschrei reagiertest Du nicht. Was würde ich drum geben, Dir noch einmal ein „Bist Du narrisch, passe auf“, hinterherrufen zu können.
Gerade sehe ich Dich wieder auf Deiner Wolke. Mit Deinem Ellenbogen schubst Du Manni an und sagst. „Das habe ich Dir doch gerade erzählt. Gleich fällt der Satz, sie ist emotional überfordert.“
Diese Anspielung beziehen sich auf die Momente als ich Dich Mama, im März und im Mai, nach dem Umsetzen aus dem E-Rolli in den anderen Rollstuhl in die Wohnung schob. Du hielst Dich, mit dem Gesicht zu mir, an den Rändern fest und schautest mich mit Deinen großen, braunen Kulleraugen unter den dichten Wimpern von unten an. In dem Moment bestandst Du für mich nur aus diesen großen Augen und dem Griff. Darauf vertrauen zu müssen, dass ich Dich vorsichtig in die Wohnung schob. Währenddessen sahst Du so klein und so verwundbar aus. Ich unterdrückte meine Tränen und antwortete auf Deine Frage, dass ich gerade „emotional überfordert bin“. „Das musst Du doch nicht.“ Und tätscheltest meine Hand. Doch, Du wirktest so furchtbar verletzlich.
Mama, wir beide hatten sicherlich eine spezielle Beziehung. Dies ändert nichts daran, dass ich Dich jetzt schon vermisse.
Wer weiß, wann und wie wir uns wiedersehen? Oder spüren?
Danke Mama, dass es Dich
Gab
Gibt
Und weiter gibt
Nachtrag: Januar 2021:
Die Trauer ist weiterhin da. Anders. Folgend zitiere ich den Satz eines Enkelkinds: „Oma Petra kommt wieder. Dann hat sie auch wieder Beine.“
Wie ich zuvor schrieb: „Und weitergibt“