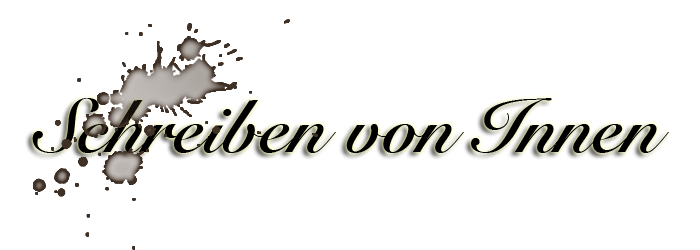Intelligenzvakuumisten, ein auf dem ersten Wort unaussprechliches Wort, welches Menschen verschiedener Arten und Denkweisen beschreiben kann.
Bereits vor zwei oder drei Jahren beschrieb ich die folgende Begegnung. Heute überarbeitete ich sie. Inzwischen kann ich sie um viele weitere Momente ergänzen, in denen ich für mich leise, und manchmal laut, sagte: „Du Intelligenzvakuumist“.
Der Begriff „Intelligenzvakuumisten“ wird in keinem Duden oder anderem Nachschlagewerk zu finden sein. Es ist eine Wortschöpfung, die erfunden und dabei selbsterklärend ist. Oft nutze ich sie, wenn ich auf Menschen treffe, die ich in ihrer Ansicht oder ihrem Verhalten so unschön empfinde, dass ich sie nur mit dieser Wortschöpfung begreifen kann.
Ursprünglich hatte ich vor, verschiedene Menschen mit ihren verschiedenen Einstellungen und Aussagen zu beschreiben. Situationen mit ihnen wieder zu geben, in denen ich voller Unverständnis den Kopf schüttelte und innerlich sprachlos dachte:
Wie kann ein erwachsener Mensch solche Aussagen treffen?
Wie kann ein erwachsener Mensch nur solche Handlungen begehen?
Wie kann ein erwachsener Mensch über so wenig Empathie verfügen und ausschließlich sich in den Mittelpunkt des Weltgeschehens setzen?
Eine Reise und das Zusammentreffen mit einem Ehepaar brachten mich dazu, die Beobachtung auf zwei Personen zu begrenzen.
Erstmalig bemerkte ich sie am Bahnhof. Ich schätzte beide auf Mitte 60. Er: Um die 1,75m groß, Brillen- und kleiner Bauch- und Brustträger mit weißen Haaren. Gekleidet in einem gestreiften Poloshirt mit Jeans. Sie: Etwas kleiner, weiße Haare mit Dauerwelle, ebenfalls in Jeans gekleidet, mit einer Bluse und einer Handtasche aus den 80er Jahren versehen. Sie fielen mir auf, weil sie merkwürdiges Schuhwerk trugen. Nicht bunt oder anderweitig auffallend, sondern in einer viel zu kleinen Schuhgröße. Er trug eine Art Sandalen, deren Zehen soweit herausragten, dass sie fast den Boden berührten. Der Blick des Betrachters wurde automatisch auf sie gelenkt. Sicherlich auch, weil diese Zehen aussahen, als hätten sie tausende Meilen barfuß Laufens hinter sich gebracht.
Bei ihr sah es gemäßigter aus. Die bestrumpften Füße steckten ebenfalls in Sandalen. Wobei nur geschätzte 3-4cm Zehen herausschauten.
Sehr schnell wirkten die Beiden auf mich als ewige Gestrige aus den neuen Bundesländern, die im Schwabenland, dem ungeliebten Westen, einfach nicht ankommen wollten. Früher war alles besser. Drüben war alles besser. Ja, sie verwendeten den Ausdruck drüben sehr häufig. Verwundert stellte ich bei dem Besuch eines DDR Museums fest, dass sie auch hier über ausgestellte Dinge der ehemaligen DDR schimpften. Es scheint ein gemeinsamer, grundlegender Charakterzug von ihnen zu sein, alles negativ zu betrachten?
Schon nach wenigen Stunden erinnerten sie mich an die bekannten drei Affen, die vollkommen meinungslos und desinteressiert erscheinen. Die drei Affen, die nichts sehen, nichts hören, nicht sprechen. Nein, das traf auf das Ehepaar nicht zu. Sie sahen alles, und sie hörten alles. Sie redeten ausgiebig. Vorrangig redeten sie bösartig und sehr abwertend über Mitreisende.
Könnte ich sächsisch zitieren, würde sich hier die Gelegenheit bieten, ausgiebig zu zitiren. Leider kann ich Dialekte nicht zitieren. Sie schimpften darüber: „Warum sind die ganzen Schwarzen hier im Bus.“ (Flüchtlinge waren Bestandteil der Reisegruppe und egal welcher Nationalität sie entstammten, alle wurden als Schwarze tituliert)
“Warum fahren die Schwarzen überhaupt mit? Die wollen sicherlich alles umsonst bekommen.“
Kaum verließ die Gruppe das Hotel, beschwerten sie sich lauthals beim Reiseführer: „Boh, die Schwarzen sind wieder so langsam. Wegen denen kommen wir bestimmt heute nirgends mehr an.“ Hinweise durch den Busfahrer, Gruppenteilnehmer oder den Reiseführer, sich nicht so respektlos und rassistisch zu äußern, ignorierten sie geflissentlich. Sie hatten eine dermaßen überzogene Wahrnehmung von sich die einen konstruktiven verbalen Austausch nicht zuließen. Verfügten sie überhaupt über eine Wahrnehmung? Oder lebten sie „zurück gezogen“ in ihrer eigenen, gestrigen Welt? Denke ich an ihr Schuhwerk (ich muss gestehen, dass ich von ihrem heimlich ein Foto machte), dass sie diesbezüglich zumindest anders sind.
Zitiert habe ich einige Sätze, die sich endlos aneinanderreihen lassen würden. Sie ließen keine Gelegenheit aus, über die Mitreisenden lautstark ihren Unmut zu äußern. Ich bekam mein Fett, aufgrund meiner Figur und meines Einschreitens weg. Mitreisende Kinder, weil sie es wagten sich ein wenig zu bewegen. Der Reiseleiter, weil er „die Schwarzen nicht wegschickte“, der „Staat, weil er Flüchtlinge überhaupt reinlässt“. Vorrangig bekamen leider die ausländischen Mitreisenden ihren Unmut zu hören. Unmut oder Dummheit? Beleidigungen wurden getätigt. Andererseits verweigerten sie die direkte Kommunikation mit ihnen und schauten, Hände vor der Brust verschränkt, über sie hinweg.
Speisten wir in einem Restaurant zu Mittag oder zu Abend, bemängelten sie das Essen, scheuchten das Personal auf oder fielen durch ähnlich gelagerte Aktionen auf.
Für ein Gemeinschaftsfoto verließen sie demonstrativ den Raum. Ich empfand es als große Respektlosigkeit. Vielleicht wollten sie ihre Schuhe und die altmodische Dauerwelle auch einfach nicht zur Schau stellen? „Ironiemodus“ aus. Sie waren mir unangenehm und ich schämte mich teilweise für sie.
Äußerungen am Denkmal der verstorbenen Roma und Sinti: „Wie, das ist alles? So ein Aufwand für die paar Toten.“ Wir sprechen von geschätzten 500.000 Menschen. Oder in einem Museum über die Nazi Verbrechen „Jetzt könnten sie aber mal Ruhe geben“ zeigten mir, welch Geistes Kind sie sind. Auf einem Friedhof sagten sie lauthals: „Da sollten man die Hälfte der Insassen des Busses eingraben“. (Blick auf die mitreisenden Ausländer)
Doch wie soll man mit solchen Menschen umgehen? Ich hätte sie am liebsten rein zufällig aus dem Bus fallen sehen und hätte vergessen ihnen die Hand zur Hilfe zu reichen. Wollte ihren dummen Dunstkreis verlassen. Mit Argumenten konnte man bei ihnen nichts erreichen. Sie leben in ihrer eigenen Welt, ihrem eigenen Kosmos und nur sie haben Recht. Ihr respektloses Verhalten widert mich immer noch an. Daher haben sie die Ehre hier als die ersten Intelligenzvakuumisten beschrieben zu werden.
Einige Monate später sah ich sie erneut, als sie auf dem Weg zu einer Veranstaltung der AfD waren.
Als ich den Text zum ersten Mal schrieb, waren mir ein solches Verhalten, und auch solche Äußerungen, von Menschen unbekannt. Inzwischen ist es salonfähig geworden und nicht nur auf Stammtischen anzutreffen.
Intelligenzvakuumisten sind überall anzutreffen. Beim Bäcker, an der Kasse im Supermarkt, in der Nachbarschaft und und und.
Wann habt ihr zum letzten Mal einen getroffen und ihn dabei vielleicht mit einer anderen Bezeichnung versehen?
Foto:pixabay.com