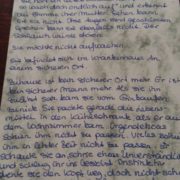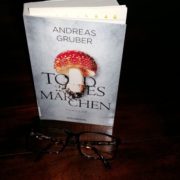„Read what I see“: Verschiedene Alltagsbeobachtungen
Häufig beobachten wir die kleinen Momente im Alltag, die wir wahrnehmen und dennoch nicht wahrnehmen. Die Besucher der Stadtbibliothek, die täglich die verschiedenen Tageszeitungen dort lesen. Die betagte Dame, die sich mit ihrem Rollator im Kreise dreht, weil sie etwas in der Handhabung falsch macht und herzhaft über sich lacht. Die vielen verschiedenen Besucher in den Cafés, die ihre Zeit aus den verschiedensten Gründen dort verbringen. Der Nichtschwabe, der versucht tiefstes schwäbisch zu verstehen und dessen Gesicht nur aus einem großen Fragezeichen besteht.
Woran erkenne ich im Schwabenland einen „Ausländer“? Damit ist nicht jemand gemeint, der eine Fremdsprache spricht oder fremd ausschaut. Im Coffee Shop am Stuttgarter Hauptbahnhof outet sich derjenige als Nichtschwabe, der folgendes bestellt: „Eine Brezel mit etwas Butter oben drauf.“ Ich gehe nun nicht auf den starken sächsischen Dialekt ein, sondern auf die Umschreibung des schwäbischen Nationalgutes. Ein Schwabe hätte ganz ordinär „Butterbrezel, bitte“ bestellt.
Gegebenenfalls auch ohne bitte hin zu zufügen.
Ich kann selten durch einen Bahnhof schlendern, ohne dass mir Menschen auffallen.
Am Fahrkartenautomat stand eine ältere Dame, die versuchte einen Fahrschein zu ziehen. Auf eine Art und Weise gekleidet, die ich heute nicht mehr oft sehe. Dunkler, langer Rock, sehr schicke Bluse mit einem Blazer darüber, Halbschuhe mit Absatz. Dazu schneeweiße, ondulierte Haare. Sie fiel mir auf, da sie einen Henkelkorb aus Bast in der Hand trug, der mindestens 50 Jahre alt sein muss. Erwartet hätte ich, dass er mit frischem Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten gefüllt gewesen wäre. Das Bild wäre für mich dann irgendwie komplett gewesen.
Unaufgefordert half ich ihr den passenden Fahrschein zu ziehen, worüber sie sich sehr freute. Ich gestand ihr nicht, dass auch ich mit diesen Fahrscheinautomaten auf Kriegsfuß stehe, wenn ich unter Zeitdruck bin oder im Nahverkehr mehr als 2 Zonen benötige.
Den ganzen Tag sah ich ihr Gesicht vor mir. Sie hatte etwas Feines und verletzliches an sich.
Kaum drehte ich mich um, sah ich ein Ehepaar, welches mir auffiel, weil, ja, weil sie merkwürdiges Schuhwerk trugen. Nicht bunt oder anderweitig auffallend, sondern in einer viel zu kleinen Schuhgröße. Beide schätzte ich auf Mitte 60 ein. Er trug eine Art Sandalen, deren Zehen soweit heraus ragten, dass sie fast den Boden berührten. Der Blick des Betrachters wurde automatisch auf sie gelenkt. Sicherlich auch, weil diese Zehen aussahen, als hätten sie tausende Meilen barfuß Laufens hinter sich gebracht.Bei ihr sah es gemäßigter aus. Die bestrumpften Füße steckten ebenfalls in Sandalen. Wobei nur geschätzte 3-4cm Zehen heraus schauten.
Komisch, was Frau plötzlich wahrnimmt. Vielleicht lag es daran, dass der Blick es Zuschauers förmlich darauf gedrängt wurde?
Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, dass mir dieses Ehepaar später erneut begegnen würde und die Hauptfiguren zum Thema „Intelligenzvakuumisten“ bilden würden.
Eine Umsteigestation weiter drückten sich mehrere ältere Ehepaare, in der Holzunterführung des Bahnhofes, die Nasen an der eingelassenen Plexiglasscheibe platt. Hinter diese ist eine kleine Sandgrube erkennbar. Irritiert fragen sie sich untereinander: „Wie soll da `mal ein Zug rein passen?“ „ Ach, das geht schon, das ist doch bald ein unterirdischer Bahnhof.“
Aha, ein unterirdischer Bahnhof, der oberirdisch eine kleine Grube zeigt. Diese kleine Sandgrube könnte vielleicht die Märklin Eisenbahn aus dem Keller daheim aufnehmen. Es übersteigt meine Fantasie und meinen Verstand, mir eine Lok der DB mit vielen Waggons in dieser kleinen Grube vorzustellen.
Die drei Pärchen gingen weiter und beharrten in ihren Gesprächen untereinander darauf, dass der neue Bahnhof nun doch nicht so tief ist. Das ganze Theater drum herum sei doch h ein wenig übertrieben.
Irgendwann geht es vom Bahnsteig in den Zug hinein. Die Fahrt beginnt.
Von früheren Klassenfahrten habe ich es in Erinnerung, dass der Proviant ausgepackt wird sobald der Zug los gerollt ist. Früher erlebte man den Geruch von kalten Frikadellen oder hart gekochten Eiern. Die obligatorischen Äpfel und Süßwaren rochen nicht.
Was aber riecht, nein stinkt, sind frisch geschnittene Zwiebeln. Erst wird die BILD Zeitung beiseite gelegt, dann die Aufbewahrungsdose geöffnet. In dem Moment habe ich es verflucht, dass sich die Fenster nicht mehr öffnen lassen. Eine Klimaanlage kann einen solchen Duft erst in vielen, vielen Stunden verarbeiten: Harzer Käse wurde ausgepackt, der mit frisch geschnittenen Zwiebeln in reichlicher Menge in kleinen Happen verzehrt wird. Der Blick dieses „Genießers“ schweifte Beifall heischend in die gesamte Runde. „Seht, so etwas leckeres ich habe, aber ich gebe nichts ab.“
Dieser Moment führte dazu, dass ich einmal den langen Zug bis nach hinten und zurück durch marschierte. Es half nichts. Dieser Geruch war überwältigend mies. Wurde er dadurch noch angereichert, dass er es sich nun gemütlich machte? Schuhe standen unter dem Abteiltisch und die löchrigen Strümpfe boten einen interessanten Anblick.
Als später der Kaffeeservice kam, wurde dieses Geruchswirrwarr sehr speziell. Für sehr lange Zeit flüchtete ich Bordbistro.
Gerne besuche ich die Leseecke in der Stadtbibliothek. Sie bietet einen reichlichen Fundus für Beobachtungen. Oft vermute ich, dass die sehr große Auswahl an Tages- und Wochenzeitungen nur einen Vorwand abgibt. Statt zu lesen, beobachten sich die einzelnen Besucher untereinander. Getränke dürfen nicht verzehrt werden, gesprochen wird kaum, gelegentlich an einem Laptop gearbeitet. Was macht dann den Aufenthalt dort so reizvoll als Nichtleser der Tageszeitungen?
Sehen und gesehen werden, beobachten und beobachtet werden? Und ein wenig lesen?
Die Schirmmütze sehr tief ins Gesicht gezogen, den Rücken tief gebeugt, die Süddeutsche Zeitung weit weg gehalten: Dieser ältere Mann sitzt mehrmals wöchentlich an gleichen Platz. Seinem Stammplatz. Bis weit in den Mittag liest er die Zeitung, auf Abstand gehalten und oft frage ich mich, mag er sich keine Lesebrille gönnen oder kann er sich keine gönnen. Zu gerne möchte ich einmal einen Blick in sein Gesicht erhaschen, doch die Schirmmütze verhindert es. Einmal glaubte ich, sehr buschige, weiße Augenbrauen gesehen zu haben. Oder mehr erahnt zu haben?
Schräg gegenüber sitzt häufig eine Frau in den 70ern. Stets sehr schick angezogen, manchmal mit Hut, manchmal ohne. Die Perlenkette und die Perlenohrringe fehlen nie. Sie liest meist DIE ZEIT oder auch die LANDLUST. Sie nimmt eine Körperhaltung ein, die mich immer an eine Primaballerina erinnert. Im 5- Sekundentakt schiebt sie mit einer automatischen Bewegung ihre Lesebrille von der Nasenspitze hoch Richtung Augen. Nie habe ich erlebt, dass sie andere Besucher betrachtet. Oder sich eine andere Tageszeitung nimmt. Vertieft in ihre Lektüre nimmt sie um sich herum nichts wahr.
Besuche ich die Leseecke will ich ebenfalls nur DIE ZEIT lesen und in anderen Tageszeitungen stöbern. Damit beginne ich, um dann in Betrachtungen zu versinken und mir auszumalen, warum wer so häufig hier ist. Welche Lebensgeschichte könnte ich von der Dame mit den Perlenohrringen erfahren? Wie mag das Gesicht des Mannes mit der Schirmmütze ausschauen?
Die Lösung wäre so einfach: Aufstehen und fragen. Und somit eventuell um einige Illusionen oder Gedankengänge ärmer zu sein?