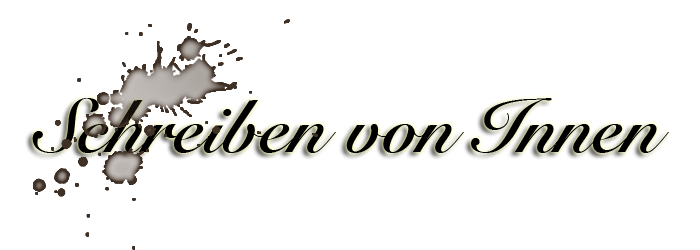Es kann nicht immer Butter sein
32 Cent kostet 1kg Mehl, das Päckchen Zucker liegt bei 69 Cent. 99 Cent sind übrig. Würde es für einen kleinen Guglhupf reichen?
Es war reiner Zufall, dass sie auf ihrem täglichen Morgenspaziergang die 8 Pfandflaschen gefunden hatte. Nie verließ sie ohne ihren alten, lädierten Trolley die Wohnung. Die langen Gummihandschuhe, die sie beim Pfandsammeln überzog, ließen sich darin gut verbergen. Eine Pfandbeute ebenfalls.
Ihr Arzt hatte ihr schon Monate zuvor Krankengymnastik für die Hüftarthrose verschrieben. Die Zuzahlungen hierzu konnte sie sich nicht leisten. Also nahm sie seinen Rat an und schmierte ihre Knochen durch tägliche Morgenspaziergänge, wann immer sie sich ohne zu große Schmerzen bewegen konnte.
99 Cent:
Zu wenig für 250g Butter. In einen Guglhupf gehörte Butter. Nein, es ging nicht. Sie benötigte, wenn sie sich dieses Jahr einen Kuchen außer der Reihe gönnen wollte, noch Eier. Zu gerne würde sie welche von glücklichen Hühnern kaufen. Es ging nicht.
Zaudernd stand sie weiterhin vor dem Kühlregal.
Ein Pfund Pflanzenmargarine: Dafür würde es reichen.
Zwei lose Eier dazu, die sie mit etwas Milch strecken würde: Ja, so würde es gehen. Vanillinzucker würde ihr ein Nachbar borgen müssen, ein kleiner, alter Rest Backpulver würde schon genügen. Wenn sie den Guglhupf gut aufbewahren würde und einige Scheiben in dem kleinen Gefrierfach einfrieren würde, hätte sie im Januar auch noch etwas von dem Kuchen.
Sie konnte sich kaum noch daran erinnern, wann es begonnen hatte. Als ihr Mann noch lebte konnten sie, trotz seiner kleinen Rente, Lebensmittel kaufen wenn sie sie benötigten. Auch gab es regelmäßig sonntags einen Braten oder zu Weihnachten eine kleine Nordmanntanne. Kleidung und Schuhe konnten erneuert werden. Einmal im Jahr gingen sie ins Theater. Selten ins Kino.
Vor 5 Jahren verstarb er an seiner Staublunge, die ihn seit dem 30. Lebensjahr plagte und dazu führte, dass er bereits mit 41 Jahren in Rente gehen musste.
Der Übergang zu der jetzigen Situation kam schleichend. Die Miete stieg stark von Jahr zu Jahr an. Die Heizkosten ebenfalls. Ihre jungen Nachbarn, die vor einigen Jahren als Studenten nebenan eingezogen waren, sprachen von „Gentrifizierung“. Was immer es bedeuten mochte, es hörte sich nicht gut an.
Sie packte die Einkäufe in ihren Trolley und lief langsam nach Hause zu ihrer kalten Wohnung. Nicht nur Lebensmittel waren in der letzten Zeit knapp gewesen, auch an der Heizung sparte sie. Die Kosten konnte sie kaum noch aufbringen. So heizte sie meist nur die Küche ein wenig, zog sich dicke Pullover an und ließ häufig das Licht aus. Radio konnte sie auch im Dunklen hören. An kalten Tagen schaltete sie gelegentlich den Kühlschrank aus und lagerte die wenigen Lebensmittel auf dem kalten Balkon.
Heiligabend:
In der kleinen Küche duftete es nach Kuchen. Der Guglhupf stand auf einer schönen Kuchenplatte, der Tisch war mit einer Spitzendecke gedeckt und die Heizung hatte sie zur Feier des Tages für einige Stunden weit aufgedreht. So saß sie in einem Kleid, welches ihr Mann ihr vor vielen Jahren zum Geburtstag geschenkt hatte, auf der Eckbank in der Küche. Die Nachbarn borgten ihr gestern nicht nur ein Päckchen Vanillinzucker, sondern legten noch ein paar frische Tannenzweige und eine dicke rote Stumpfkerze dazu. Nun roch es in der Küche nach Weihnachten und Kuchen. Heimelig.
Im Radio lauschte sie, wie in jedem Jahr, dem Weihnachtsoratorium von Bach. Es würde ein langer Abend werden, den sie sehr genießen würde.
Bei „Ehre sei Dir, Gott gesungen“ legte sie den noch geschlossenen Brief der Hausverwaltung, der gestern per Einwurfeinschreiben in ihrem Briefkasten lag, unter die Tischdecke.
Stevan Paul: Der große Glander
Klappentext:
Der junge Künstler Gustav Glander wird im New York der 1990er-Jahre zum Star der Eat-Art-Bewegung. Seine kulinarisch geprägten Arbeiten und Aktionen sind spektakuläre Inszenierungen und treffen den Nerv der Zeit, Kritiker und Sammler stürzen sich auf die Werke des schweigsamen Deutschen. Doch der Erfolg bereitet ihm Unbehagen. Nach einem Flug in die Heimat verschwindet Glander. Spurlos.
Zwölf Jahre später: Ein Restaurant in Hamburg. Es herrscht Hochbetrieb in Küche und Service. Im Speiseraum sitzt auch der bekannte Kunstkritiker Gerd Möninghaus. Dem kommt einer der anderen Gäste seltsam bekannt vor. Zu spät fällt Möninghaus ein: War das etwa Glander? Als kurze Zeit später bislang unbekannte Skizzen des verschollenen Künstlers in der Redaktion auftauchen, beginnt der engagierte Journalist zu recherchieren. Seine Suche führt ihn von Hamburg nach New York, nach St. Moritz, an den Bodensee und ins Allgäu – und er macht dabei eine überraschende Entdeckung.
Stevan Paul geht in seinem ersten Roman »Der große Glander« der Frage nach, was Essen zur Kunst macht. Er erzählt von der Liebe, vom Heimkommen und von der Freiheit, sich immer wieder selbst neu erfinden zu können. Herausgekommen ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die Sorgfalt und das Authentische, eine Liebeserklärung ans Kochen – und ein großer Spaß.
Tja, mit diesem Klappentext ist bereits alles gesagt:
Das Buch handelt von Sehnsüchten, der Liebe, Wesentlichen, von der Rückbesinnung auf die wirklich wichtigen Dinge. Vom Finden der eigenen Berufung, vom Heimkommen und letzten Endes vom Ankommen im Leben.
Ein Buch welches ein „Hach“ Gefühl gibt und mich zufrieden die letzte Seite schließen ließ.
Die Handlung ist schnell erzählt. Gustav Glander, ein junger Mann vom Land, aufgewachsen im Allgäu, entwickelt sich im New York der 90er zu einem bekannten jungen Künstler. Einem Star. Er macht „Eat-Art“ Kunst, die spektakulär ist und bei seinen Fans sehr gut ankommt. Genannt wird er der große Glander. Eher menschenscheu scheint er mit seinem Ruhm nicht so zufrieden zu sein und hinterfragt ihn.
Als sein Vater stirbt, fliegt er nach Deutschland und verschwindet spurlos.
12 Jahre später glaubt ein Kunstkritiker ihn in einem Restaurant zu erkennen. Da er gezwungenermaßen auf der Suche nach einer guten Story ist, beginnt er mit seinen Recherchen.
Wird er den großen Glander finden? Das Rätsel um sein verschwinden lösen können? Lösen können, was der große Glander nun im zweiten Leben macht?
Die Antwort lautet ja.
Warum gefällt mir das Buch so gut? Zum einen, weil es in mir dieses „Hach“ Gefühl erzeugte. Weil der Einband sehr schön gestaltet ist. Noch mehr gefällt mir aber der Inhalt. Stevan Paul war mir als Autor vollkommen unbekannt. Mir war nicht bewusst, dass ich ein Buch lese, welches von einem Foodblogger. Kochbuchautor, Rezepteerfinder geschrieben wurde.
Dementsprechend wird in diesem Buch nicht nur über die Freiheit, sich selbst zu erfinden geschrieben. Bei jeder Gelegenheit werden selbstverständlich Gerichte beschrieben. Jeder Charakter hat einen Bezug zum Kochen und das fließt im Buch mit ein. Nein, es ist kein Kochbuch, sondern ein Buch über das Leben, über das Kochen, über das trinken über verschiedene Küchen und und und.
Die Gerichte wurden übrigens nicht erfunden, sondern von Stevan Paul bereits so gekocht.
Foto:pixabay.com
Jörg Maurer: Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt (Kommissar Jennerwein ermittelt, Band 11)
Klappentext:
In einer verschneiten Berghütte hoch über dem idyllisch gelegenen Kurort will Kommissar Jennerwein mit seinem Team feiern. Einmal ohne Ermittlungsdruck und Verbrecherjagd gemütlich am Kaminfeuer sitzen und Geschichten erzählen. Aber was bedeuten die blutigen Spuren im Schnee, die draußen zu sehen sind? Warum kreist eine Drohne über der Hütte? Und welcher unheimliche Schatten streift durch die Nacht? Während drunten im Kurort die Polizeistation verwaist ist und eine Gestalt leblos in einem versperrten Keller liegt, erkennt Jennerwein, dass er in eine Falle geraten ist, aus der es kein Entkommen gibt. Wenn er sein Team retten will, muss er mit dem Tod Schlitten fahren…
Es ist mutig von einem Autor zwei Bücher einer Serie, hier um den Kommissar Jennerwein, in einem Jahr herauszugeben. Die letzte Ausgabe erschien gerade vor einem halben Jahr. Als ich „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“ mit den 425 Seiten in den Händen hielt und zu lesen begann, wusste ich nicht wie ich es einsortieren sollte. Sollte dieses Geschichte ein Weihnachtskrimi werden und das Experiment verunglückte kolossal?
Drei Erzählstränge: Kommissar Jennerwein feiert Weihnachten mit seinen Kollegen auf seiner Berghütte, ein paar Snowboarder tummeln sich im Schnee undein Stinkbombenstreich in Kommissar Jennerweins Schule während seiner Jugendzeit beherrschen das Buch. Spätestens zum Schluss werden sie miteinander verwoben, doch wirkt es nicht authentisch. Das ganze Buch plätschert langweilig vor sich hin, ich quälte mich von Seite zu Seite. Immer in der Hoffnung: Nun geht es richtig los.
Diese Hoffnung wurde gnadenlos enttäuscht. Den Erzählstrang mit den Jungenderinnerungen empfand ich als überflüssig. Ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass er nur als Seitenfutter diente. Bücher von Jörg Maurer glänzen nicht durch eine überschaubare Seitenanzahl. Im Gegenteil.
Die Bände 1 bis 9 aus der Kommissar Jennerwein Reihe glänzten mit Sprachwitz, der mich beim Lesen immer wieder laut lachen liess. Oder absurden Gedankengänge einer sprechenden Birke oder eines Serienkillers, der sich darüber moniert, dass er keine Rente bekommen wird, da er nicht in die Rentenkasse einzahlen kann. Solche Dinge, die zum unfehlbaren Stil des Jörg Maurer gehören, fehlen leider.
Mit welchem Gefühl gehe ich aus dem Buch? Ich fühle mich veräppelt. Sollte dies eine Ausgabe für Weihnachtshasser sein, so ist die Aufgabe misslungen. Am meisten ärgere ich mich, dass ich das Buch nicht schnell genug in die Ecke legte, der Hoffnung aufsaß, es bekommt nun die Kurve. Selten habe ich meine Lebenszeit so verschwendet. An einem Buch verschwendet.
Immerhin kenne ich nun den Namen der Pathologin.
Ob ich zukünftige Bücher von Jörg Maurer in die Hand nehmen werde und sie lesen werde? Stand heute: Nein