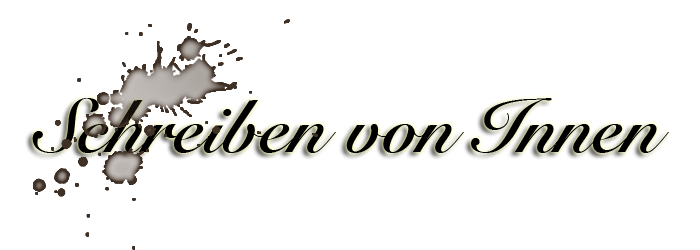„Read what I see:“ Das Freibad
Mohrendatsch: Ich traue meinen Augen kaum als ich es lese. Früher kaufte ich ihn, der auch als Matschbrötchen bezeichnet wurde, gerne auf dem Schulweg für 50 Pfennig, vorausgesetzt es war noch etwas vom Taschengeld übrig. Reingebissen und eine süße Zufriedenheit machte sich im Bauch breit. Schnell wurde die süße Masse, die etwas aus dem Brötchen quoll, abgeschleckt bevor hineingebissen wurde. Begleitet von einem Lächeln, dass auch die Augen erreichte. Nun stehe ich vor dem Kiosk in dem kleinen Freibad und sehe es auf der Frühstückskarte angeschlagen. Auch heute beginne ich in Erinnerung daran zu lächeln. Gut, der Preis ist mit 1,20€ wirklich ein wenig happig. Da ich weit nach der Frühstückszeit im Freibad ankam, werde ich nicht beurteilen können, ob es heute noch so schmeckt wie früher.
Betrachte ich die Umgebung, so scheint die Zeit und auch die Eintrittspreise stehen geblieben zu sein. Das Kassenhäuschen aus Holz ist in weinrot gestrichen und eine sehr freundliche Kassiererin begrüßt jeden Gast als würde er sie daheim in ihrem Wohnzimmer besuchen. Links davon ist ein weiteres Gebäude aus Holz. In hellem gelb gestrichen befinden sich dort die Behinderten WCs. Direkt daneben schließt sich der in lila gestrichene Kiosk an. Vom Kiosk her schallt laut SWR3 herüber, was nicht zu der Atmosphäre des Bades passt. Eine Slush Eisbar, daneben ein Zigarettenautomat und die Eistruhe von Langnese runden das Speiseprogramm draußen vom Kiosk ab. Die große Terrasse ist mit vielen Sonnenschirmen bestückt, die aufgrund des heutigen starken Windes zusammengeklappt sind.
Eine kleine Gruppe Männer und Frauen, die italienisch sprechen unterhält sich laut. Hände und Füße werden dazu ebenfalls eingesetzt, so dass ein unruhiger Eindruck entsteht. Allzu gerne würde ich nun einen Mohrendatsch essen und ganz in Erinnerungen eintauchen. Stattdessen höre ich unfreiwillig den Italienern zu und höre nur „Puta, Puta“.
Drei Frauen setzen sich gemeinsam in die Nähe. Jede hat einen Latte Macchiatto vor sich auf dem Tisch stehen und ein Magnum Stieleis in der Hand. Alle drei tragen einen Bikini. Und alle drei sollten besser auf einen Badeanzug umsteigen? Nicht nur wegen der integrierten Cups.
Einen Tisch weiter teilen sich drei Jungs im Alter von ca. 10 Jahren eine Portion Pommes und „streiten“ sich verbal um den Piekser aus Holz, mit dem die Pommes gegessen wird. Wer den Piekser in der Hand hält, bekommt die nächste Pommes. Der blonde Junge gewinnt die Diskussion häufiger und bekommt mehr von der Portion ab als die anderen, die es nicht zu stören scheint. Grinsend, nicht angeberisch schauend, piekst er wieder eine Pommes auf und lässt es sich schmecken. Weiterlesen
„Read what I see:“ Sonntagmorgen
10 Uhr früh an einem Sonntagmorgen. Die Sonne scheint und die ersten Menschenmassen stürmen das Café, um sich mit Brot und Brötchen zu versorgen. Lag es an einer falschen Planung oder an einem kleinen Menschenansturm zuvor? Die ersten Backwaren sind ausverkauft. Normale Brötchen sind im Angebot nicht mehr vertreten. Das schwäbische Nationalgericht, die Brezel, ist ebenfalls ausverkauft. Leise, leise Aufschreie sind zu hören. Nicht jeder Kunde hat Verständnis. Die Frustrationsgrenze ist, je nach Ausschlafmodus, verschieden ausgeprägt. Manche laufen nur ein paar Meter weiter, um sich zu versorgen, während andere mit hängenden Schultern zu ihrem Auto gehen. Werden sie auf dem Balkon, im Garten oder in einer überhitzten Wohnung ihr Frühstück zu sich nehmen? Oder ihre Nacht verlängern und gemütlich im Bett frühstücken?
Im Café herrscht hingegen eine entspannte Atmosphäre. Kaffeeduft zieht durch die Räumlichkeiten. Die Terrasse ist gut besucht. Entspannt sitzen einige vor ihren Croissants, die in den Kaffee gestippt werden oder mit Marmelade belegt in Zeitlupe zum Mund geführt werden. Andere trinken einen frisch gepressten Orangensaft oder stoßen sich mit einem Piccolo zu. Die Kinder betteln um eine weitere Portion Nutella und lassen sich diese von der Kellnerin bringen. Nach einer kurzen Nacht genieße auch ich einen Kaffee mit viel Milch. Mein Croissant kann sich noch nicht entscheiden, ob es von mir in den Kaffee gestippt werden möchte oder einfach pur den Weg in meinen Magen finden möchte.
Ich spüre eine Veränderung in der Atmosphäre noch bevor ich es sehe. Schlauchlippe (siehe http://schreiben-von-innen.de/read-what-i-see-sollen-wir-heute-den-hund-grillen/) betritt mit ihrer Mutter, Ehemann und einem Chihuahua das Café. Alle drei umweht ein starker Duft nach Schweiß, feuchtem Keller und nassen Hund. Ein wenig bin ich verärgert. Sonntagmorgens möchte ich entspannen und nicht von unangenehmen Düften umweht werden. Den Hund stramm an der Leine hinter sich herziehend, entern sie die Terrasse. Tische werden für die drei Personen zusammengeschoben und der Hund unter einem Tisch platziert. Schlauchlippe hat ihre Beine in eine pinkfarbene ¾ Hose gezwängt, der Oberkörper ist mit einem bunten Top bekleidet. Sämtliche Muttermale, Falten, lockeres Gewebe und Achselhaare werden unvorteilhaft zur Schau gestellt. Die Füße sind in Trekkingsandalen gequetscht worden. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sie und Anhang noch einen Spaziergang oder eine Runde im Wald drehen würden, wo die Trekkingsandalen einen sinnvollen Einsatz finden könnten. Alle drei beginnen zu frühstücken. Überrascht nehme ich die besondere Möglichkeit wahr ein belegtes Brötchen zu verzehren. Die Mutter nimmt ihr Brötchen in die Hand, beugt ihren Mund zu diesem und zieht mit ihren Zähnen die Wurstscheibe in den Mund. Es liest sich nicht nur so befremdlich, es sieht auch befremdlich aus. Die Wurstscheibe wurde vernichtet und mit drei großen Bissen geht das Brötchen den selbigen Weg. Ab in den Bauch, und zwar schnel,l lautet vermutlich die Devise? Sie führt die Kaffeetasse zu ihrem Mund und verzieht das Gesicht. Heißer Kaffee lässt sich nicht so schnell trinken. Das drei Schlucke Prinzip funktioniert hier nicht. Schlauchlippe vernichtet ihr Frühstück ebenfalls in einem atemberaubenden Tempo. Ob sie ausgehungert ist oder ihre Finger schlichtweg die Sehnsucht verspüren wieder auf ihr Smartphone zu hacken, kann ich nicht beurteilen. So voll ihr Mund auch sein mag, es hindert sie nicht abfällig über andere Gäste und nicht anwesende Menschen zu sprechen. Ihre Mutter pflichtet ihr stets bei, der Ehemann schweigt. Der kleine Hund schaut mit treuen Blick von seinem Platz unter dem Tisch zu ihnen hinauf. Ob er auf einen Krumen hofft oder ihre Unterhaltung auf ein anderes Thema lenken möchte, kann man nur erahnen. Mir stellt sich die Frage, ob sich die Tiere ihre Herren/Herrinnen aussuchen oder umgekehrt? Was mag der kleine Kläffer nur verbrochen haben, um bei diesem Dreigestirn zu landen?
Foto: pixabay.com, rawpixel
Kolumne: Menschen im Hotel – im Frühstücksrestaurant
Es geht doch nichts darüber das Frühstücksrestaurant im Hotel mit nüchternem Magen zu betreten. Nachdem man der Dame am Stehpult die Zimmernummer genannt hat, die geflissentlich abgeglichen wird, strömt einem bereits die übliche Duftwolke aus Damen- und Herren Eau de Toilette entgegen. Dazu eine Prise Haarspray, das Aroma der zuvor verwendeten Duschgele, die Mischung verschiedener Eierspeisen und über all´ dem der Duft von frischem Kaffee. Wie kann ich da noch von Duft schreiben? Es mieft und es trifft meine Magengrube als hätte mir jemand einen leichten Schlag verpasst. Kaum sitze ich bequem und nippe an meinem Kaffee, ist dieses Duftdurcheinander vergessen. Ich nehme es nicht mehr war, sondern sitze mitten drin. Meine im Gehirn für die Registrierung von Gerüchen zuständigen Synapsen machen gerade eine Pause. Während ich den Kaffee trinke, wundere ich mich über die Menschenschlange am Frühstücksbuffet. Ich muss mich korrigieren, weniger über die Schlange, sondern über das was den Weg auf die Teller findet. Ob es Eierspeisen, Backwaren oder Käse ist – Hauptsache die Portionen sind groß. Der Weg zur Müslibar oder der weitläufigen Ecke mit Obst wurde dabei noch nicht einmal abgegangen. Was treibt die Gäste sich so über die Auswahl zu stürzen? Hunger. Oder der Gedanke nicht zu wissen, wann es die nächste Mahlzeit gibt. Oder lockt die sehr appetitlich angerichtete Auswahl. Oder liegt es daran, dass das Frühstück Teil der Übernachtungsgebühr ist und das bestmögliche herausgeholt werden muss. Man hat ja schließlich dafür bezahlt. Vielleicht trifft ein Punkt zu, vielleicht mehrere.
Mir Gegenüber sitzt ein Mann, dessen Tischmanieren so ungewöhnlich sind, dass ich immer hinschauen muss. Zwar versuche ich mich hinter der Tageszeitung zu verstecken, es gelingt mir leider nicht. In kurzen Hosen und mit einem T-Shirt bekleidet sitzt er breitbeinig auf dem Stuhl. Er unterhält sich mit einem weiteren Gast. Die Sprache verstehe ich kaum, wenige Worte erinnern mich an meinen Russischunterricht. Vor ihm liegt ein großer Teller, auf dem sich ein Stapel mit Käse und ein Stapel mit Schinken befindet. Mit aufgestützten Ellenbogen knallt er die Gabel in die „Berge“ und schaufelt sie sich in den Mund. Bisher war mir nicht bekannt, wie schwer eine Gabel beladen werden kann. Der Mund ist noch fast gefüllt, da wird die nächste Fuhre eingeführt. Fasziniert beobachte ich, wie schnell diese Mengen in den schlanken Körper rutschen. Dieses Spiel findet seine Fortsetzung über einige Tellerladungen. Ich habe keine Idee, warum er nur diese einseitige Nahrung in diesen Mengen zu sich nimmt. Vielleicht unterzieht er sich einer Cortisonbehandlung und leidet unter Nahrungsmittelallergien?
Endlich bediene ich mich ebenfalls am Buffet und lege am Tisch die Zeitung beiseite. Mir schräg gegenüber sitzt ein Mann mit strahlendblauen Augen und Drei-Tage-Bart. Der Anzug passt zu seiner Augenfarbe und ich stufe ihn als attraktivsten Mann im Raum ein. Er nippt an seinem Kaffee, verzieht den Mund und wendet sich wieder seinem Laptop zu. Mit einer Affengeschwindigkeit schlägt er auf die Tastatur, stöhnt zwischendurch, tippt weiter, schaut kurz in den Raum, um dann erneut zu tippen. Wer mag er sein? Ein Vertriebler, der zum Quartalsende noch Umsatz vorweisen muss? Ein Fundraisingmanager, der sich mit unwilligen Sponsoren herumschlägt? Ein sich in Scheidung befindlicher Ehemann, der sich mit seinem Rechtsanwalt austauscht? Oder mit seiner Noch-Ehefrau? Zumindest ist er jemand, der früh am Morgen noch nicht seine Ruhe gefunden hat oder sie bereits verloren hat. Wer in diesem Raum konnte den Tag ruhig starten? Wer steckt bereits in seiner täglichen Tretmühle? Wo würden sie sein, wenn sie sich nicht in diesem Hotel aufhalten würden? Wir sehen jemanden und denken, was könnte er machen? Wer könnte er sein? Was macht er in seinen eigenen vier Wänden?
Darüber wird am nächsten Freitag nachgedacht.