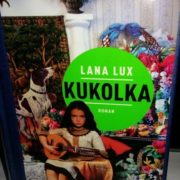Kolumne: Manisch-Depressiv: Ich bin meiner Erkrankung (inzwischen) dankbar Teil 2
Dieser Meinung war er auch und überwies mich an eine Psychiaterin.
An dem besagten ersten Arbeitstag telefonierte ich mit einer Freundin zu der ich fuhr. Sie telefonierte mit dem Hausarzt, er mit der Psychiaterin. Am nächsten Morgen ging ich zu ihr hin und sie gab mir eine Einweisung für die Psychiatrie.
Sehr gut kann ich mich daran erinnern, wie ich die Psychiatrie stundenlang zu Fuß suchte, endlich fand und in irgendeinem Zimmer ein Gespräch hatte. Ein langes Gespräch. An die gestellten Fragen kann ich mich nicht erinnern. Nur an die Aussage, dass ich bitte aufhören solle zu sagen: „Das ist normal; da muss ich durch,“ wenn es um schlimmer Erlebnisse ging.
Irgendwann wurde mir angeboten die Station anschauen. Wie unbedarft war ich. Durch die Aussagen meiner Freundin dachte ich, ich komme in eine Art Kurklinik. Denkste: Die Tür der Station ging zu und ich konnte sie nicht mehr von innen öffnen Dazu waren die Fenster vergittert. Da dämmerte es mir: Ich bin in der Klapse!
Trotzdem behielt ich meine große Klappe: Meinte noch: „Danke für´s zeigen, aber in ein 3-Bett Zimmer gehe ich nicht, außerdem muss ich zur Arbeit und ich würde ich ein paar Tagen wiederkommen.“ Dieser lange, große Pfleger machte mir daraufhin sehr lange klar, dass es nicht mehr gehen würde. Letztendlich durfte ich in Begleitung kurz nach Hause, Koffer packen und von daheim eine Email an den Arbeitgeber schicken.
Knappe 2 Monate hielt ich mich dort auf. Die Diagnose wurde gestellt und rückwirkend ist mir die sehr gute Betreuung bewusst. Täglich gab es mehrere Gespräche mit der Psychologin und mit dem klinischen Direktor: Irgendwie war ich für sie spannend. Im ersten Moment war mir die Diagnose egal. Ich erkannte die Dimension dahinter noch nicht. Mir ging es ausschließlich darum den Suizid verhindern zu lassen. Heute weiss ich, dass er ein Symptom der schweren Depression war und kein Dauergedanke. Damals wollte ich nur gezwungen werden weiterzuleben. Später begriff ich, was die Diagnose bedeutet, welche Einschränkungen sie für mein weiteres Leben bedeutet und ich büchste aus, um den letzten Schritt zu machen. Ich fand mich auf der geschlossenen Station wieder und kämpfte mit mir. Es war die Hölle, denn nun wollte ich nicht mehr dort bleiben. Irgendwann akzeptierte ich es und nach den knapp zwei Monaten war ich über den Aufenthalt froh. Ansonsten wäre irgendwann im Januar 2005 von mir der Plan umgesetzt worden. Heute für mich unvorstellbar, dass ich jemals so gedacht und geplant hatte.
Natürlich war der Aufenthalt nicht immer angenehm. Der Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik mit Akutaufnahme kann nicht angenehm sein. Es gab einige fixierte, viele schreiende Menschen. Oder einen Sexualstraftäter, der mich immer angrabschte und gegen den ich nichts machen konnte. „Auch er ist auch krank“ musste ich mir sagen lassen. Privatsphäre war nicht vorhanden, die sanitären Zustände schlimm. An eine Situation kann ich mich noch gut erinnern: Eine junge Frau, mit Baskenmütze bekleidet, befragte den ganzen Tag und die ganze Nacht auf der Station Patienten. Ständig trug sie Notizen in ihr Klemmbrett ein. Einmal schaute sie mich an und meinte nur: „Fett kann man auch absaugen“. Ich weiß noch, wie ich in schallendes Gelächter ausbrach und mich nicht mehr so krank fühlte. Während ich auf das Medikament (Valproinsäure) eingestellt wurde, nahm ich 17kg zu. Zusätzlich zu meinem üblichen Übergewicht war das eine Menge.
Später erfuhr ich, dass sie Medizinstudentin war, eine manische Phase hatte und mit einem Medikament zwangsbehandelt wurde. Meiner kleinen Schwester erzählte ich von der Diagnose und wo ich mich befand. Ihre Telefonate drangen zu mir durch. Später besuchte mich mein Vater (der gute 500km entfernt wohnt) mit meiner Mutter. Das rechne ich ihm noch heute hoch an. Seine Unsicherheit konnte ich daran erkennen, dass er sich hinter seiner BILD Zeitung versteckte. Ist ja auch nicht leicht, wenn sich die eigene Tochter umbringen will und er davon durch meine Freundin erfährt.
Wir haben nie wirklich im Detail darüber gesprochen. Doch habe ich das Gefühl, dass er ein Gespür dafür bekommen hat, auch wenn nicht viele Worte darüber verloren werden. Natürlich über die inzwischen vorhandene Erwerbsunfähigkeit, aber nicht über die Erkrankung an sich.
Meine Mutter ist da ganz anders: Noch heute erwähnt sie, wie schlimm ich damals ausgeschaut habe. Hallo: Ich stand unter Tavor, wurde auf Valproinsäure eingestellt und wurde vor mir selber geschützt. Sie kann die Diagnose nicht verstehen: „Stelle Dich nicht so an“ sind gerne verwendete Sätze.
Dem Klinikaufenthalt schloss sich eine Rückfallprophylaxetherapie an. Was war ich ein schwieriger Fall! Als ich zum ersten Termin erschien drückte mein Körper folgendes aus: Hier bin ich, mache mich wieder heile, ich will wieder die alte sein. Und komme mir auch bloß nicht mit der Aussage, ich soll beruflich kürzer treten. Mit 40 Stunden in der Woche lasse ich mich nicht abspeisen.
In der Rückfallprophylaxe geht es darum zu lernen, Anzeichen zu erkennen, bewusster zu leben um Rückfälle zu vermeiden. Um Manien vorzubeugen bedeutet es unter anderem konkret
- Einen geregelten Schlafrhythmus zu haben (Schlafmangel führt gerne zu Manien)
- Langstreckenflüge zu vermeiden
- Flackernde Lichter (wie in Diskotheken)
Es geht darum, was kann ich machen, um die Arbeitskraft zu erhalten?
Für mich bedeutete es, irgendwann akzeptieren zu müssen, dass ich nicht über 40 Stunden arbeiten sollte, was im Vertrieb sehr schlecht machbar ist. In den Folgejahren war ich zwar vor Manien gefeit, allerdings nicht vor Depressionen. Inzwischen kann ich gut erkennen, wenn ich mich in einer leichten oder mittelschweren Depression befinde und kann aufpassen, dass es zu keiner Verschlimmerung kommt.
Nein, ich muss mich korrigieren. Im Jahr 2014 erwischte mich die schlimmste Depression seit 2004. Ihr war ein sehr anstrengendes Jahr voraus gegangen und so sehr ich auch aufpasste, es erwischte mich schier über Nacht.
Soll ich froh sein, dass ich fast 10 Jahre davor gefeit war? Gefeit vor dieser Schwere? Ja, heute sehe ich es so. In der Phase war ich, wenn ich überhaupt über ein Gefühl verfügte, wütend darüber, dass ich erkrankte. Wütend über das letzte (nicht das aktuelle) Mietverhältnis, in dem auch mit Psychoterror seitens des Vermieters agiert wurde. Komischerweise funktionierte ich in dieser schlimmen Phase, um dann Monate später zusammen zu klappen.
Solche Selbstvorwürfe mache ich mir dann. Statt mir zu sagen: Hey, schaue, was Du alles Positives geleistet hast.
Manchmal, aber auch nur manchmal, wünsche ich mir in unbedachten Momenten, eine klitzekleine Manie. Eine Hypomanie für wenige Stunden. Mich einfach wieder ein wenig überdreht und kraftvoll zu fühlen. Die Manie ist aber die Phase, die mich am meisten ängstigt. Bei mir schlägt sie besonders damit zu, dass ich überhaupt kein Gefühl für Gefahr habe oder mich bewusst und provokativ in diese begebe.
Mit Medikamenten ist sie schnell behoben. Sollte ich nicht einsichtig sein, würde ein kurzer Zwangsaufenthalt in der Psychiatrie folgen. Nach der medikamentösen Einstellung auch die Entlassung. Die medikamentöse Behandlung schlägt schneller an als bei einer Depression.
Wie kann ich nach diesen Zeilen schreiben, dass ich dieser Erkrankung inzwischen dankbar bin? Es gibt sicherlich Betroffene und Angehörige, die mir für diese Aussage den Kopf abreißen würden!
Ich bin ihr dankbar, weil ich mich von sehr vielen oberflächlichen Menschen getrennt habe.
Ein großer Bekanntenkreis ist mir nicht wichtig. Wichtig sind mir Freunde, die auch Freunde sind.
Durch den Befehl, die spätere Akzeptanz, dass ich nicht mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten soll und kann, lernte ich, dass Arbeit nicht alles ist. Bis dahin identifizierte ich mich über Leistung und über Erfolg. Als das weg fiel, musste ich mich auf andere Dinge konzentrieren, bzw. diese suchen. So kam ich auf Reiki und werde dies auch wieder praktizieren, wenn ich eine neue Lehrerin gefunden habe.
Plötzlich hatte ich Freizeit, entdeckte neue Interessen, entdeckte mich. Entdeckte neue Ehrenämter. Sich mit sich selber auseinanderzusetzen kann anstrengend, mühsam, ermüdend sein. Aber auch produktiv.
Niemals hätte ich mich zuvor getraut zu schreiben. Ich muss mich korrigieren: Zu schreiben schon, aber nicht dies anderen zugänglich zu machen. Inzwischen weiß ich, dass ich damit Menschen erfreue.
Mein Umgang mit Menschen hat sich geändert. Ich lasse es zu emphatisch zu sein, lasse mich mehr auf zwischenmenschliche tiefe Bindungen ein.
Kurzum: Ich habe eine andere Lebensqualität erreicht. Lebe bewusster.
Seit 2012 Jahren beziehe ich eine Erwerbsunfähigkeitsrente, darf und kann noch einige Stunden arbeiten.
Dies geht natürlich mit sehr starken finanziellen Einschränkungen einher. Meine ehemaligen guten Gehälter werde ich nicht mehr erreichen. Die angestrebte Rentenhöhe ist Schnee von gestern. Natürlich erschreckt mich der regelmäßige Gedanke daran. Es sind existentielle Gedanken. Ich habe bedeutend weniger Einkommen gegen eine andere Form von Lebensqualität eingetauscht. Eine Lebensqualität, in der ich nicht mehr so belastbar bin wie früher. Das bin ich wirklich nicht. Eine Lebensqualität, die mir in meiner persönlichen Entwicklung und im zwischenmenschlichen Bereich zu mehr positiven Beziehungen verholfen hat.
Was bleibt ist die Zerrissenheit:
Darf es mir denn schlecht gehen? Darf ich sagen, dass ich abschmiere, die Stimmung geht und die Depression kommt? Auch heute kommen die Antworten: „Du hast doch gelernt, damit umzugehen. Wie kann Dir dann das jetzt noch passieren?“
„Stelle Dich nicht so an. Reiße Dich zusammen.“ „Dir geht es doch gut, warum passiert jetzt was, hast doch keinen Grund“. (Bevorzugt von meiner Mutter)
Dann fühle ich mich schuldig und in Zugzwang. Denke, dass ich überzeugen muss. Überzeugen zu müssen, wo es eigentlich nichts zu überzeugen gibt. Ich bin manisch-depressiv und ich kann nichts dafür. Über die Ursachen ist zu wenig bekannt (am Ende der Kolumne gibt es einige abschließende Infos dazu). Ob es einen genetischen Grund gibt, einen biologischen Grund, oder wie von manchen gar vermutet als Folge eines Missbrauches, ich muss die Ursache nicht mehr suchen. Ich bin betroffen und habe es akzeptiert.
Gelegentlich verunsichert es mich, dass ich die Ursachen warum ich ruhiger geworden bin nicht kenne. Es macht mich auch traurig Liegt es an der Rückfallprophylaxe, in der ich lernte ein „gemäßigteres“ Leben zu führen? Liegt es an meinem Alter? Wehwehchen, Einsicht und Reife lassen einen früher spontanen Schritt nun in aller Konsequenz vorab überdenken. Oder liegt es an den Medikamenten? Macht mich die Valproinsäure ruhiger? Macht sie mich reifer? Dämpft sie mich? Nimmt SIE mir ein Teil meiner Persönlichkeit weg? So empfinde ich es manchmal: Wo ist das übermütige, verrückte Huhn geblieben? Was an mir ist ICH, wer bin ich, was ist die Krankheit Was ist an mir echt? Der Zustand der Vergangenheit oder der jetzige Zustand?
Soll ich das Medikament über einen längeren Zeitraum absetzen, um diesen Fragen auf den Grund gehen zu können? Kann ich dieses Risiko eingehen? Ist es das wert?
Oder kann ich endlich akzeptieren, dass das Wissen um meine Manische Depressive Erkrankung und ihre Behandlung mir nicht nur eine andere Lebensqualität ermöglicht hat (und dafür bin ich dankbar), sondern auch einen Teil von mir genommen hat?
—————————————————————————————————————————————————————————-
In Gesprächen wurde mir gesagt, dass durchschnittlich 15 bis 30% der Bipolar Erkrankten Suizid begehen. Der Durchschnitt der Erkrankten ist ab einem Alter von 55 Jahren arbeitsunfähig. 10 bis 15% der Erkrankten erleben mehr als 10 Episoden in ihrem Leben. Auch ich habe diese bereits locker geschafft.
In Deutschland soll es ca. 2 Mio. Menschen geben, die eine Bipolare Störung haben. Mir persönlich erscheint diese Zahl zu hoch, doch kann ich es wirklich nicht einschätzen.
—————————————————————————————————————————————————————————–
Fakten:
Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störung e.V.
Postfach 800 130
21001 Hamburg
Dort oder über die Homepage kann auch ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung angefordert werden.
www.dgbs.de
Hier werden u.a. Informationen für Betroffene und Angehörige gut aufbereitet zur Verfügung gestellt. Sehr interessant ist auch der Bereich: DGBS und kreativ.
Ursachen:
Genetische Faktoren:
Vererbung: Bei einem betroffenen Elternteil wird eine Vererbungswahrscheinlichkeit von 10 bis 20% eingeschätzt
Biologische Faktoren:
Bei Patienten mit Bipolaren Störungen sind Veränderungen im Neurotransmitterhaushalt
festgestellt worden. Neurotransmitter = chemische Botenstoffe. Diese sind an der Weiterleitung von Nervenimpulsen beteiligt. Bei Depressiven fand sich zB ein Mangel an Noradrenalin und Serotonin.
Mittlerweile geht man davon aus, dass nicht einzelne Veränderungen der Neurotransmitter, sondern eine Störung des Gleichgewichts dieser ursächlich ist.
(Quelle: Homepage: www.dgbs.de)
Liz Obert:
Gerne möchte ich noch auf Fotografin Liz Obert und ihr Projekt „Dualities“ hinweisen. Ein Projekt, das mich berührt.
https://www.lizobert.com/
Liz Obert ist Fotografin und führte als manisch depressiv Erkrankte jahrelang ein verstecktes Leben. Wie ich, hat sie eine Bipolare Störung II, sprich die manischen Episoden überwiegen. Jahrelang ließ sie sich in der Öffentlichkeit nichts anmerken. Erst zu Hause, gab sie sich wie sie ist.
In ihrer Fotoserie „Dualities“ zeigt sie die Zerrissenheit dieser Menschen. Ein auch mir so bekannter Zustand. Sie macht zwei Bilder: Das erste Porträt zeigt die Menschen in ihrer kranken Phase, das zweite Bild, wie sie gerne in der Öffentlichkeit gesehen werden möchten. Versehen mit Notizen der Erkrankten.
Eine sehr ausdrucksvolle Fotoserie, die mich berührt.
(Quelle: brigitte.de und lizobert.com)