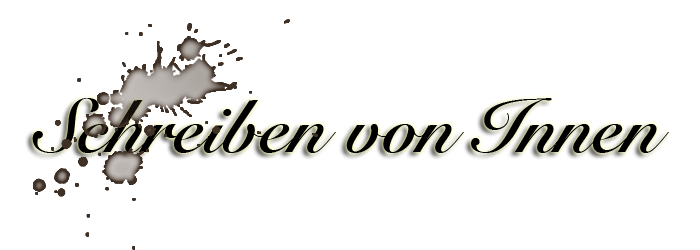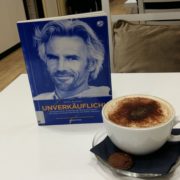Mein Utopia ist in mir. Es ist mein inneres Utopia. Ich spüre es bei einer geführten schamanischen Reise. Nur dort erlebe ich es. Es ist kein Ort in der Fremde oder eine Gesellschaftsform, sondern eine Reise in die Anderswelt.
Wie beginne ich die Reise in die Anderswelt?
Während der Schamane, oder die Schamanin trommelt, beginne ich meine schamanische Reise. Ich spüre den Zugang zu dem wunderbaren Wasserfall und betrete die Anderswelt, indem ich unter ihm entlang gehe und das Wasser auf mich regnen lasse. Manchmal erscheint dahinter eine grüne Wiese auf der ich gefühlte Stunden barfuß spazieren gehe. Wenn ich den Wasserfall durchschritten habe, treffe ich meist bereits dort auf mein Krafttier, meinen Seelengefährten. Es begleitet mich auf den Reisen in diese Welt, beschützt mich, führt mich und gibt Heilungsimpulse. Nie habe ich es gesucht. Es war einfach da.
Bei meinen ersten schamanischen Reisen war mein Krafttier ein Frosch. In seiner ganzen Körpergröße ging er mir bis zum Knie. Meist gingen wir nur spazieren, während er mich anlächelte. Oder ich setzte ihn auf meine Schultern und hüpfte mit ihm durch die Gegend und strich seine Beine, die herunter hingen. Aus diesen Begegnungen ging ich sehr gestärkt, aber auch mit einem großen Gefühl an Geborgenheit hervor. Dies hält lange über die jeweilige schamanische Reise hinaus an.
Später wurde er von einem Bären abgelöst. Einem großen, braunen Bären, der mir meist auf seinen Hinterpfoten entgegentrat und mich mit seiner Größe überragte. Er trug eine verkehrtherum getragene, rote, Baseballmütze auf seinem Kopf. Bei unserer ersten Begegnung fand ich diese Mütze merkwürdig, doch scheint sie irgendwie zu ihm zu gehören. Er stellte sich als „Shaggy“ vor. Bei diesem Namen blieb es.
Selten stellte ich ihm Fragen, meist bekam ich ungefragt Antworten oder Umarmungen.
Nach einer solchen Reise mit „Shaggy“ fühle ich mich ebenfalls gestärkt, entspannter, nachdenklicher und meine Seele wurde intensiv berührt. Ja, hier wird meine Seele berührt.
Auf einer meiner ersten schamanischen Reisen, die ich während einer Phase körperlicher und psychischer Erschöpfung machte, bekam ich den Impuls endlich eine berufliche Entscheidung zu treffen. Nachdem ich den Wasserfall passierte, holte mein Bär mich ab und wir gingen schweigend gemeinsam im Wald spazieren.
Immer wieder schaute er mich an und umarmte mich zwischendurch lange. Schlussendlich nahm er mich an die Hand und führte mich aus dem Wald heraus.
Wir schauten auf einen großen Firmenpark mit vielen großen und wenigen kleinen Bürotürmen. Ich schluckte, die Luft zum Atmen wurde mir für einen kurzen Moment knapp und dann weinte ich. Weinte und ließ endlich los.
Auch den Rückweg verbrachten wir schweigend. Als ich nach dieser schamanischen Reise aufwachte, fühlte ich mich nicht mehr so erschöpft. Spürte mich endlich wieder und von beruflichen Ängsten befreit. Ich traf nicht sofort eine Entscheidung. Doch die Saat wurde erfolgreich gelegt und ging zum richtigen Zeitpunkt auf.
Nach dieser kleinen Einführung möchte ich nun über meine letzte schamanische Reise erzählen. Sie war eine besondere Reise, die ich nie vergessen werde.
Es war ein Tag im Herbst, als wir uns im Wald trafen, um gemeinsam in einer Gruppe zu reisen. Ich mochte diesen Treffpunkt, der in der Nähe eines kleinen Baches lag. Zuvor ging ich zu dem Bach um innezuhalten, meine Füße einzutauchen und ein Dankesritual abzuhalten. Von dort lief ich zu der Gruppe, die damals aus 5 Personen bestand. Nach der Begrüßung breiteten wir unsere mitgebrachten Decken aus auf die wir uns legten. Die Schamanin nahm ihre selbst hergestellte Trommel in die Hand und begann langsam und leise zu trommeln. Bereits mit den ersten Tönen entspannte ich mich und ließ los. Die erreichte Frequenz bewirkt bei manchen Schläfrigkeit. Mir helfen die tiefen und lauten Töne in Trance zu gelangen und meine geistige Reise zu beginnen. Als sich das Tempo steigerte, erreichte ich bereits meinen Eingang zur Anderswelt. Den Eingang zur unteren Welt. Meine Reise begann. Ich sah den rauschenden und hohen Wasserfall, der aus einer langen Bergwand floss. Unten sammelte er sich in einem kleinen, fußtiefen Teich. Neben dem Teich blühten viele Blumen, ähnlich denen, die man in Bauerngärten findet. Schaute ich nach oben, sah ich einen strahlendblauen Himmel, in dem viele Falken ihre Runden drehten. Ich durchschritt den Teich und stellte mich unter den Wasserfall. Blieb zuerst auf der Stelle stehen, um mich dann mit ausgebreiteten Armen lange um die eigene Achse zu drehen. Ich genoss den Wasserstrahl von oben, den Duft der Blumen neben mir und wollte den Wasserfall am liebsten nicht mehr verlassen. Einige Momente später durchschritt ich ihn und kam in einen Wald. Es war ein heller Wald mit vielen Bäumen, die sehr hoch und breit vom Umfang waren. Trotzdem ließen ihre Kronen viel Licht durch. Ich lehnte mich an einen der Bäume und wartete auf mein Krafttier, den Bären. Oft verbrachten wir unsere Begegnungen indem er mich gefühlte Stunden in den Armen hielt und mir über den Kopf strich, während ich ihn kraulte. Dabei schwiegen wir meist, es sei denn er stellte mir Fragen. Die Antworten auf diese fand ich selten sofort. Oft stellten sie sich erst Tage oder Wochen später ein. Er beschäftigte mich über die schamanischen Reisen hinaus und gab mir wertvolle Impulse. An diesem Tag war er lange nicht zu sehen. Ich blieb alleine im Wald, ging spazieren und berührte viele Bäume. Bei manchen verweilte ich länger, bei einigen weniger lange. Nach einiger Zeit kam Shaggy um die Ecke, stellte sich erst zu seiner vollen Höhe auf und umarmte mich lange. Dann drückte er mich, um folgend zu sagen: „Ich kann nicht bleiben, ich muss zu Anna.“ Er ließ mich los, drehte sich um und ging den Weg zurück, den er gekommen war. Die Trommel schlug schneller und holte mich aus der Anderswelt zurück. Ich setzte mich auf und dachte an Anna. Eine Freundin, die damals schwer erkrankt war. Den Zeitpunkt und Dauer dieser schamanischen Reise musste ich mir nicht notieren. Er blieb in meinem Kopf. Wir besprachen die Erfahrungen, die wir während dieser Reise gemacht hatten, doch verließ ich die Gruppe früher. Unruhe hatte mich gepackt. Vergeblich versuchte ich den Ehemann von Anna telefonisch zu erreichen. Im Krankenhaus vor Ort erhielt ich keine weitere Auskünfte, außer: „Wir haben die Angehörigen verständigt, es dürfen nur noch ihre Angehörigen zu ihr.“ Ich wusste, ihr Ehemann würde mich jetzt nicht zu ihr lassen.
Anna hatte zum zweiten Mal Leukämie bekommen. Beim ersten Mal wurde sie erfolgreich mit einer Chemotherapie behandelt. Doch wenige Jahre später kam die Leukämie zurück. Dieses Mal bekam sie Stammzellen transplantiert. Die Behandlung als Vorbereitung zur Transplantation zuvor war nicht ungefährlich und die Zerstörung des Immunsystems stellte ein immenses Risiko dar. Die Stammzellentransplantation lag nun eine Woche zurück. Einmal konnte ich sie besuchen und in einem kurzen wachen Moment mit ihr sprechen. Sie war ein kleines Häufchen Mensch, welches durch Schläuche an eine ganze Wand voller Geräte angeschlossen war. Es summte, piepte, rauschte in fast jeder Sekunde aus einem von ihnen. Ihr Mann blockte Besuch von Freunden zu dem Zeitpunkt meist ab und gab auch mir nur widerwillig Auskünfte über ihren Zustand. Drei Tage nach der Information „Es dürfen nur noch Angehörige zu ihr“ durfte ich sie kurz besuchen. Sie war intubiert, aber sie lebte. Von nun an ging es ihr langsam besser. Im Laufe der Wochen und Monate wurde sie nicht mehr intubiert und die Geräte an der Wand, die sie versorgten, wurden stets weniger. Sie kämpfte weiterhin mit den Nebenwirkungen der zuvor erhaltenen Chemotherapie und der jetzt eingesetzten Medikamente. Manchmal saß ich stundenlang an ihrem Bett und strickte, während sie schlief. Zu dem Zeitpunkt befürchtete sie, dass sie nicht mehr aufwachen würde, wenn sie tagsüber schlief und niemand neben ihr sitzen würde. Irgendwann erzählte sie mir, dass es eine Abstoßungsreaktion der Stammzellen gegeben hätte und sie daran fast gestorben wäre. In der letzten Sekunde konnten die Ärzte es in den Griff bekommen. Bei einem meiner späteren Besuche, als es ihr deutlich besser ging, plauderte sie ganz locker darüber, welch tolles Schmerzmittel Morphium wäre. Allerdings würde es ihr merkwürdige Träume bescheren. Kichernd erzählte sie mir von dem folgenden:
„Hi hi, einmal träumte ich sogar von einem großen Bären mit einer roten Baseballmütze, der mich ganz lange in den Arm nahm und dann mit mir Ewigkeiten tanzte. Ein tanzender Bär. Ich kann doch gar nicht tanzen. Aber es tat so gut, dass er mich in den Arm genommen hat.“
Ich schluckte und fragte mit leiser Stimme: „ Weißt Du noch, wann das gewesen ist?“
„Der Tag an dem ich fast gestorben wäre.“
Im Laufe unseres Gespräches tastete ich mich vorsichtig an die Details heran. An dem Tag meiner letzten schamanischen Reise verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand mittags dramatisch.
Während ich im Wald auf meiner Decke lag, der Trommel lauschte, kämpfte sie um ihr Leben.
Während ich mich in der Anderswelt aufhielt ging Shaggy, unser Krafttier, zu ihr.
Was an diesem Nachmittag im Oktober geschah: Wir wissen es nicht. Wir wissen nur: Shaggy war bei ihr.
Foto: Pixabay.com, Alexas_Fotos